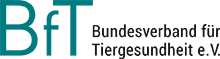Innovationen in der Impfstofftechnologie
Der Nutzen innovativer Entwicklungen ist unbestritten. Dies gilt auch in besonderem Maße für die Tiergesundheitsindustrie, die rund zehn Prozent ihres Umsatzes in Forschung & Entwicklung investiert. Gerade in der jüngsten Vergangenheit konnten beispielsweise moderne Impfstofflösungen und Weiterentwicklungen zur Parasitenbekämpfung wesentlich zur Gesundheitsvorbeuge beitragen.
Eine wirksame Seuchenbekämpfung, tiergerechte Darreichungsformen, verantwortliche Antibiose-Konzepte oder Produkte zur Behandlung von Diabetes und anderen Stoffwechselstörungen oder allergischen Hauterkrankungen für Hobbytiere sind ebenfalls Erfolge innovativer Forschung der Tiergesundheitsindustrie. Im Nutztierbereich hat dies zudem unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Erkenntnisse aus der Biotechnologie wirken beschleunigend und kostenreduzierend auf dem Weg von der Grundlagenforschung bis zur Praxisreife. Die Bekämpfung neuer Erreger wird durch sie häufig überhaupt erst möglich.
Europäische Aufgabe
Forschung & Entwicklung ist kein nationaler Alleingang. Die Forderung nach einem innovationsfreundlichen Umfeld stellt sich auch auf europäischer Ebene. Zur Förderung der Innovation hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) im vergangenen Jahr eine Ad Hoc Expertengruppe für neue Tierärztliche Therapien (ADVENT) ins Leben gerufen. Die Task Force soll die Entwicklung neuartiger Tiergesundheitsprodukte, wie beispielsweise auf Basis von Stammzellen oder monoklonaler Antikörper, unterstützen und Leitlinien zu den Zulassungsanforderungen dieser Tierarzneimittel zur Verfügung stellen. Ihre Arbeit setzt bereits in der Grundlagenforschung ein.Seit Jahren arbeitet inzwischen der Ausschuss für Tierarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP) der EMA. Ein besonderes Augenmerk lag dabei u. a. auf der zentralen Zulassung neuartiger Tierarzneimittel. Mehr als 180 positive Stellungnahmen zur Zulassung neuer Tierarzneimittel wurden seither abgegeben. Für mehr als 800 Wirkstoffe wurden Empfehlungen zur Festlegung von Rückstandshöchstmengen (MRLs) erarbeitet. Aktuell hat die Europäische Kommission in einem Revisionsvorschlag zum europäischen Tierarzneimittelrecht außerdem Veränderungen vorgesehen, die u. a. den administrativen Aufwand reduzieren und so Ressourcen für Innovationen verfügbar machen sollen.

Wie kommt der Impfstoff ins Tier?
Applikation ist Bestandteil der Zulassung – Applikationsmethode richtet sich nach Impfstoff und Tierart. Die Art und Weise, wie Impfstoffe an Tiere verabreicht werden, ist wesentlich für die Immunanwort und Sicherheit verantwortlich und damit von hoher Praxisrelevanz. In der Nutztiermedizin wird eine Vielzahl von verschiedenen Impftechniken angewendet. Die möglichen Applikationsvarianten nehmen einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wirksam und sicher ein Impfstoff ist. Die Applikation ist deshalb auch Bestandteil der Impfstoffzulassung.

Der Weg des Erregers
Man unterschiedet bei der Applikation die Impfung über die Schleimhaut (mukosal) und die Impfung mittels Injektion (parenteral). Bei der mukosalen Immunisierung wird meist ein Lebend-Impfstoff auf Schleimhautoberflächen, z. B. der Nase, des Auges oder in Maul und Rachen des Tieres aufgebracht. Damit folgt die Impfung im Allgemeinen der natürlichen Infektionsroute des entsprechenden Erregers. Es kommt zu einer lokalen Reaktion der körperlichen Abwehr. Beispielsweise werden in der Geflügelhaltung mukosale Immunisierungen über das Trinkwasser oder mittels Spray zur Impfung großer Tierzahlen eingesetzt. Das eye drop-Verfahren ist für die Einzeltierbehandlung ab dem 1. Lebenstag geeignet. Die Möglichkeiten zur mukosalen Applikation von inaktivierten Vakzinen werden derzeit untersucht.

Was geht in oder unter die Haut?
Die parenterale Impfung kann intramuskulär (in den Muskel), subkutan (unter die Haut) oder intradermal (in die Haut) erfolgen. Verschiedene attenuierte (abgeschwächte) Lebendimpfstoffe und inaktivierte Impfstoffe sind zur Injektion geeignet. Die Vakzine wird mittels Nadel oder durch Druck entsprechend tief in das Gewebe eingebracht. Die Wirksamkeit eines Impfstoffes nach parenteraler Applikation beruht auf einer systemischen Immunantwort. Im Vergleich zwischen der intramuskulären und der subkutanen Route spielen oft praktische Aspekte und die Verträglichkeit eine Rolle. Für einen ausreichenden Impfschutz kann die systemische Immunantwort essentiell sein. Nach intradermaler Applikation wird der Impfstoff von bestimmten Zellen des Immunsystems aufgenommen und zu den lokalen Lymphknoten transportiert. Dort erfolgt dann die wesentliche Stimulierung des Immunsystems. Aus diesem Grund wird bei vielen – jedoch nicht bei allen – Impfstoffen im Vergleich mit der intramuskulären Applikation bei einer geringeren Antigenmenge dieselbe Wirksamkeit erreicht. Die nadellose intradermale Applikation hat den Vorteil, dass Krankheitserreger nicht durch das Impfbesteck von Tier zu Tier übertragen werden. Eine Sonderstellung nimmt die in ovo-Vakzinierung von Geflügelimpfstoffen ein, die einen sehr frühen Schutz von Küken ermöglicht und dem Schutz des neugeborenen Tieres dient. Dies ist wichtig, wenn Infektionen vorgebeugt werden soll, die sehr junge Tiere betreffen.
Erfolgsmodelle
Bei Säugetieren gibt es aus der Bekämpfung von Tollwut und Schweinepest bei Wildtieren gute Erfahrungen mit der oralen Immunisierung durch Köder. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass diese Erkrankungen erfolgreich bekämpft werden konnten. Die Applikationsart und die Impfmethode haben einen großen Einfluss auf die Wirksamkeit und Unschädlichkeit eines Impfstoffes. Die diesbezüglichen Angaben der Hersteller sollten daher unbedingt berücksichtigt werden. Die eine ideale Applikationsmethode, die für jeden Impfstoff und alle Tierarten geeignet ist, ist nicht verfügbar.

Abdruck Text und Foto
(nur in Verbindung mit dieser Meldung)
honorarfrei bei Quellenangabe.
Weitere Informationen:
Bundesverband für Tiergesundheit e.V.
Dr. Sabine Schüller
E-Mail bft@bft-online.de