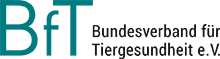Impfungen bei der Katze
Gegen diese Krankheiten können Katzen durch eine Impfung geschützt werden:
Katzenseuche
Die Katzenseuche, auch Feline Panleukopenie genannt, ist eine hoch ansteckende und weit verbreitete Viruskrankheit. Die Impfung gegen Katzenseuche gehört deshalb zu den sogenannten Core-Impfungen: Gegen diese Erkrankungen sollte nach den Leitlinien der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) jede Katze zu jeder Zeit durch Impfung geschützt sein.
Katzen aller Altersstufen können erkranken, aber vor allem ungeimpfte junge Katzen (besonders im Alter von 6 bis 16 Wochen) sowie abwehrschwache Katzen sind gefährdet. Die Todesrate kann bis zu 90 Prozent betragen. Das Panleukopenievirus wird von infizierten, erkrankten, aber auch von genesenen Tieren mit allen Ausscheidungen, vor allem aber über den Kot, verbreitet. Auch gesund erscheinende Katzen können Virusausscheider sein.
Wie wird die Katzenseuche übertragen?
Durch seine große Widerstandsfähigkeit kann der Krankheitserreger in der Umwelt viele Monate ansteckungsfähig bleiben und stellt somit eine ständige Bedrohung für alle ungeimpften Tiere dar. Die Ansteckung erfolgt daher meist nicht durch direkten Kontakt, sondern indirekt über kontaminierte Umgebung und Gegenstände wie auch Schuhwerk oder Kleidung. Deshalb sind ungeimpfte Tiere, die nur in der Wohnung gehalten werden, ebenfalls gefährdet.
Nach einer Inkubationszeit von etwa 4 bis 6 Tagen – das ist die Zeit zwischen der Ansteckung und den ersten Krankheitserscheinungen – verweigern die Tiere das Futter, zeigen Mattigkeit und Erbrechen. Daneben tritt häufig Fieber auf. Durchfall kann zwar vorkommen, ist aber wesentlich seltener als beim Hund. Während des Krankheitsverlaufes kommt es durch rapiden und starken Abfall der Zahl weißer Blutkörperchen zu einer Verminderung der Abwehrfunktion des Organismus. Dieses natürlichen Schutzapparates beraubt, können sich auch andere Erreger im Körper ungehindert vermehren und Anlass zu weiteren Komplikationen sein.
Durch eine jahrzehntelang praktizierte Impfpraxis tritt die Feline Panleukopenie heute nur noch selten auf. Wenn aber ein Seuchenzug auftritt, kommt es bei ungeimpften Tieren (vor allem bei immunologisch untrainierten Wohnungskatzen) und in Tierheimen zu hohen Verlusten. Daher sind regelmäßige Impfungen weiterhin unerlässlich.
Katzenschnupfen
Die Bezeichnung „Katzenschnupfen” ist im Grunde irreführend, denn meist handelt es sich bei dieser Infektionskrankheit um keinen harmlosen Schnupfen, sondern um eine schwerwiegende, manchmal sogar lebensbedrohliche Infektion. Der Begriff "Katzenschnupfen” hat sich jedoch eingebürgert.
Katzenschnupfen wird durch mehrere Erreger hervorgerufen: Herpesvirus, Calicivirus, Bordetellen und Chlamydien.
Die Impfung gegen die beiden wichtigsten beteiligten Erreger Felines Herpesvirus (frühere Bezeichnung: Felines Rhinotracheitisvirus) und Felines Calicivirus wird als Core-Impfung eingestuft.
Wie wird der Katzenschnupfen übertragen?
Kranke Tiere scheiden Schnupfenerreger hauptsächlich über Nase, Augen und mit dem Speichel aus. Das gilt auch für genesene, äußerlich gesund erscheinende Tiere, die oft lebenslang infiziert und potenzielle Ausscheider sind. Die Ansteckung erfolgt in der Regel durch direkten Kontakt, Erreger können aber auch durch Gegenstände eingeschleppt werden.
Welche Symptome zeigen sich bei Katzenschnupfen?
Die Inkubationszeit von 2 bis 6 Tagen ist sehr kurz. Faktoren, die bei Katzen zur Verminderung der Widerstandsfähigkeit führen, spielen beim Krankheitsausbruch oftmals eine bedeutende Rolle. Die Tiere bekommen Fieber, niesen häufig, haben verklebte Augen und Nasenlöcher mit wässrigem, später eitrigem Ausfluss. Speichelfluss, Abgeschlagenheit und Futterverweigerung sowie Geschwüre in der Maulhöhle und an der Hornhaut des Auges werden gleichfalls beobachtet. Selbst wenn eine Genesung erfolgt, bleiben häufig Spätschäden (Erblindung, chronischer Augen- oder Nasenausfluss, Schweratmigkeit u. a.) zurück.
Während es insbesondere bei ungeimpften Jungkatzen, die viel Kontakt zu anderen Katzen haben (Tierheim, Züchter, Tierpension), bei Infektionen der oberen Atemwege zu einer Entzündung der Nasenschleimhaut mit Nasenausfluss, Niesen, Atemnot, Husten, Entzündung von Luftröhre und Lidbindehäuten kommt, verlaufen solche Infektionen bei älteren und geimpften Tieren in der Regel ohne Symptome. Bei älteren, ungeimpften Tieren kann es zu einer persistierenden (andauernden) Infektion mit zeitweise massiver Erregerausscheidung kommen. Dadurch wird die Umwelt kontaminiert und das Virus innerhalb der Katzenpopulation weiterverbreitet.
Seit einigen Jahren wurden in verschiedenen Ländern, wie den USA, England, Frankreich aber auch in Deutschland und der Schweiz vereinzelt schwere Verlaufsformen auch bei erwachsenen Tieren beschrieben, gegen die die Impfung keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bietet. Diese Verlaufsformen werden auf spontan neu entstehende aggressive Varianten des felinen Calicivirus zurückgeführt.
Chlamydien-Infektion (Chlamydiose)
Chlamydien sind Bakterien, die beim Katzenschnupfen mitbeteiligt sind und bevorzugt die Schleimhäute im Kopfbereich besiedeln. Infolgedessen treten vor allem Entzündungen der Augenbindehaut (manchmal nur einseitig), aber auch von Nase und Rachen auf. Die Übertragung erfolgt durch engen Kontakt von Katzen untereinander. Tierheimkatzen, Zucht- und Ausstellungskatzen sowie Katzen, die während des Urlaubs in Tierpensionen gegeben werden, sind besonders gefährdet. Durch Impfung gefährdeter Katzen kann der Krankheitsverlauf gemildert werden. Chlamydien von der Katze können nachweislich bei immungeschwächten Personen auch zu Infektionen beim Menschen führen.
FeLV-Infektion
Die früher landläufig als Katzenleukose bezeichnete Infektion wird heute nach ihrem Erreger, dem felinen Leukämie-Virus, als FeLV-Infektion bezeichnet. Die FeLV-Infektion ist eine heimtückische Virusinfektion. Durch Testung und Impfung konnte die Infektion in vielen Regionen Deutschlands stark zurückgedrängt werden, stellt aber dennoch eine Gefährdung besonders für Jungkatzen dar. Nicht-infizierte Katzen können durch eine Impfung vor einer schweren, tödlichen Verlaufsform geschützt werden.
Wie wird die FeLV-Infektion übertragen?
Die Hauptinfektionsquelle ist der virushaltige Speichel. Eine Übertragung kann vor allem bei gegenseitigem Beschnuppern und Belecken, etwa bei gegenseitiger Fellpflege, und durch Biss- und Kratzwunden erfolgen. Kater stecken sich oft bei Rangkämpfen durch Beißereien an. Infektionsgefahr besteht vor allem bei freiem Auslauf und in Gruppenhaltung mit Neuzugängen/Fremdkontakten, bei gemeinsamer Benutzung von Futternäpfen, Wasserschalen und Katzentoiletten. Welpen können über das Muttertier noch während der Trächtigkeit (intrauterin), über die Muttermilch oder bei der Pflege infiziert werden. Trotz Infektion können Katzen oft jahrelang gesund erscheinen. Sie können aber teilweise das Virus dauerhaft unerkannt ausscheiden und die Seuche so verbreiten.
Wie sehen die Folgeerscheinungen der FeLV-Infektion aus?
Das Krankheitsbild ist sehr vielfältig. Häufig treten untypische Krankheitsanzeichen auf, unter anderem können die Tiere an unerklärlichem Gewichtsverlust, dauernder Abgeschlagenheit, Zahnfleischentzündungen oder chronischen Durchfällen leiden.
Diese Symptome sind hauptsächlich dadurch bedingt, dass das Abwehrsystem der Katze durch die Infektion geschwächt wird und Folgeinfektionen begünstigt werden. Jede unklare chronische Erkrankung kann auf eine FeLV-Infektion hinweisen. Hier kann ein Bluttest Sicherheit schaffen. Der langfristige Verlauf hängt von der Immunlage der infizierten Katze ab. Im Idealfall kann die Katze die Viren nach der Infektion abblocken und Antikörper bilden. Etwa ein Drittel der Katzen kann die Viren erst dann aufhalten, wenn sie schon das Knochenmark infiziert haben. Sie erscheinen oft jahrelang klinisch gesund, die Erkrankung ruht, kann bei ihnen aber wieder aufflammen. Ein weiteres Drittel – meist junge Katzen - schafft es nicht, die Viren aus dem Blut zu eliminieren. Bei dieser schweren Verlaufsform erkranken die Katzen immer wieder fiebrig und sterben in der Regel innerhalb von drei bis fünf Jahren.
Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
Die Feline Infektiöse Peritonitis (FIP), die im deutschen Sprachgebrauch als ansteckende Bauchfellentzündung bezeichnet wird, ist eine virale Infektionskrankheit bei Katzen, die heutzutage als die bedeutendste infektiöse Todesursache bei der Katze anzusehen ist. Am häufigsten erkranken junge Katzen im Alter zwischen sechs Monaten und zwei Jahren und immunschwache Tiere.
Der Erkrankung an FIP ist eine Infektion mit felinen Coronaviren vorausgegangen, die sich im Dünndarm ansiedeln und insbesondere bei Katzenwelpen Durchfall verursachen können. Bei einigen Katzen kommt es zur Mutation der Coronaviren. Diese Coronavirenvarianten lösen dann die FIP aus.
Welche Symptome zeigen sich bei der Felinen Infektiösen Peritonitis?
Die FIP äußert sich in einem ersten Stadium oft unspezifisch in Form von Fieber, Appetitmangel, Müdigkeit und Gewichtsverlust. Im weiteren Verlauf kommt es zusätzlich zu Symptomen wie Körperhöhlenergüssen und/oder Entzündung der inneren Organe. Im typischen Verlauf wird durch die Ergüsse der Bauch prall, die Katze bekommt zunehmend Atembeschwerden. Es kann zu Nierenentzündungen, Leberentzündungen mit Gelbsucht, chronischem Durchfall, Lymphknotenschwellungen, Augenentzündungen und sogar zu zentralnervösen Störungen wie Bewegungsstörungen und Krämpfen kommen. Die Diagnose der FIP-Erkrankung ist problematisch und am lebenden Tier kaum sicher zu stellen. Durch die Kombination verschiedener diagnostischer Möglichkeiten lässt sich allerdings die Sicherheit der Verdachtsdiagnose FIP erhöhen. Eine Impfung schützt in gewissem Maß nur die Katzen, die noch keinen Kontakt mit Coronaviren hatten.
Bis vor kurzem galt FIP als nicht heilbar. Jüngste Studien zeigen Therapieerfolge mit antiviralen Medikamenten.
Tollwut
Die Tollwut ist eine tödlich verlaufende Virusinfektion, die auch für den Menschen fatal ist. Sie ist deshalb anzeigepflichtig. Infizierte, ungeimpfte Tiere müssen lt. Tollwutverordnung getötet werden. In Deutschland ging die Infektionskette vom Fuchs aus, der die Tollwut auf seine Artgenossen, andere Wildtiere, Haustiere und den Menschen übertragen hat. Die Ansteckung erfolgt in der Regel durch den Biss eines tollwütigen Tieres. Dabei dringt virushaltiger Speichel in die Bisswunde ein. Eine Ansteckung mit infektiösem Speichel ist aber auch über andere, kleinste Verletzungen und sogar Schleimhäute (Auge, Mund) möglich. Nach der Ansteckung dringt das Virus über das Nervengewebe ins Gehirn vor an und verursacht dann die Tollwut-spezifischen Erscheinungen wie Verhaltensstörungen, Unruhe, Scheu, Schreckhaftigkeit, klägliches Miauen oder Speichelfluss. Es kann sogar zu Angriffen selbst auf vertraute Personen mit Beiß- und Kratzwut kommen. Der Tod tritt unter zunehmender Lähmung meist nach wenigen Tagen ein. Die Tollwut beim Fuchs gilt in Deutschland seit 2008 als getilgt. Ebenso wie für Hunde, gilt auch für Katzen und Frettchen bei Reisen in andere EU-Mitgliedstaaten eine Impfpflicht, das heißt eine gültige Tollwutimpfung muss nachgewiesen werden. Für Reisen in bestimmte Endemiegebiete wird der Nachweis eines Antikörpertiters von ≥ 0,5 IE/ ml gefordert. Gegen Tollwut geimpfte Tiere sind entsprechend der Tollwutverordnung bei einem Kontakt mit seuchenverdächtigen Tieren bessergestellt.
Empfehlungen für reine Wohnungskatzen
Laut Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin StIKo Vet (Leitlinien zur Impfung von Kleintieren, StIKo Vet, 5. aktualisierte Auflage 2023) werden für reine Wohnungskatzen ohne Kontakt zu anderen Tieren FeLV- und Tollwutimpfungen aufgrund des fehlenden Kontaktes zu anderen Tieren als verzichtbar angesehen Eine ordnungsgemäße Grundimmunisierung der Core-Komponenten bleibt auch bei Wohnungskatzen unverzichtbar. Über erforderliche Auffrischungsimpfungen sollte individuell nach Alter und Lebensumständen des Tieres sowie ggf. auf Basis des jeweiligen Antikörperstatus entschieden werden.
Werden Tiere – auch nur vorübergehend – in Tierpensionen untergebracht, z.B. wenn die Besitzer im Urlaub sind, sollte in jedem Falle eine vollständige Impfung gegen alle Core-Komponenten vorliegen. Unter diesen Umständen kann auch bei Wohnungskatzen eine Impfung gegen Non-Core-Erreger angebracht sein.
Zuletzt aktualisiert: 07/08/2023
Download
Abdruck Text und Foto
(nur in Verbindung mit dieser Meldung)
honorarfrei bei Quellenangabe.
Weitere Informationen:
Bundesverband für Tiergesundheit e.V.
Dr. Sabine Schüller
E-Mail bft@bft-online.de
Sobald es neue Inhalte in diesem Bereich gibt,
können wir Sie per E-Mail benachrichtigen.
Hier können Sie sich anmelden.